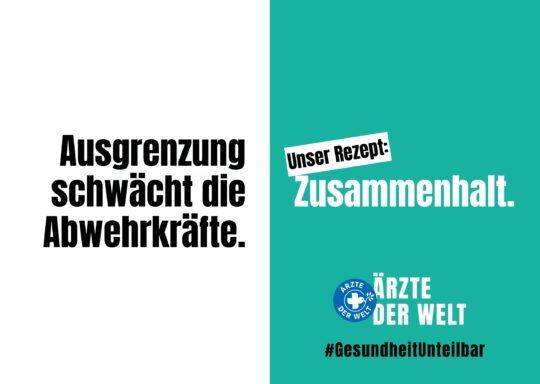Abbau von Bürokratie in der Gesundheitsversorgung von Leistungsbeziehenden nach Asylbewerberleistungsgesetz
Ärzte der Welt engagiert sich seit 2006 in der gesundheitlichen Versorgung und
Beratung geflüchteter Menschen in Deutschland. Wir erleben in unseren Projekten, wie
die Einschränkungen durch § 4 AsylbLG (und Öffnung durch § 6 AsylbLG) und das in
einigen Bundesländern immer noch etablierte Papierkrankenscheinsystem zu
enormem administrativen und bürokratischen Aufwand, Unübersichtlichkeit,
Unklarheit und Unsicherheit bei allen Beteiligten (Geflüchteten, Ärzt*innen,
Behördenmitarbeitenden) sowie zu bedenklich großem Raum für Interpretation und
Willkür und damit letztlich zu erheblichen Barrieren im Zugang zu notwendiger
medizinischer Versorgung für zahlreiche geflüchtete Menschen führen. Die
Gesundheitsversorgung von Geflüchteten entspricht zumindest in den Ländern ohne
elektronische Gesundheitskarte nicht dem Bedarf. Verschiedene internationale
Menschenrechtsgremien haben Deutschland diesbezüglich bereits gerügt. Außerdem
zeigen Studien, dass die Einschränkungen im Zugang zu medizinischer Versorgung
teurer sind als der Zugang entsprechend des Leistungskatalogs der gesetzlichen
Krankenkassen.
Die wissenschaftliche Evidenz zeigt eindeutig, dass die Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte für Geflüchtete den Zugang zu Gesundheitsversorgung für
Asylsuchende erheblich erleichtert, damit positive Effekte auf die Gesundheit
geflüchteter Menschen hat sowie eine erhebliche Entlastung für die
Leistungserbringenden darstellt.
Die Bundesregierung hat dies bereits erkannt und im Koalitionsvertrag die Absicht
erklärt: „Wir wollen den Zugang für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zur
Gesundheitsversorgung unbürokratischer gestalten. Minderjährige Kinder sind von
Leistungseinschränkungen bzw. -kürzungen auszunehmen.“
Der Bezugszeitraum für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde
kürzlich verlängert von 18 auf 36 Monate. Das bedeutet, dass geflüchtete Menschen
nun doppelt so lang unter unübersichtlichen, bürokratischen Vorgängen und einer
unzureichenden Gesundheitsversorgung leiden werden. Dies ist aus medizinischer Sicht
höchst bedenklich, denn so könnte sich der Gesundheitszustand vieler Geflüchteter
massiv verschlechtern und bestehende gesundheitliche Probleme könnten sich
langfristig verschärfen. Die Verlängerung bedeutet aber auch, dass effektiv mehr Menschen unter die Regelung fallen und Behörden, Ämter und auch Arztpraxen
insgesamt mehr Menschen innerhalb dieses bürokratischen Sondersystems verwalten,
betreuen und versorgen müssen. Der Verwaltungsaufwand wird sich voraussichtlich
erhöhen. Eine Umsetzung des sowieso im Koalitionsvertrag angekündigten Vorhabens
ist vor diesem Hintergrund noch dringlicher geworden.
Zu beachten gilt in diesem Zusammenhang auch, dass Menschen ohne geregelten
Aufenthaltsstatus ebenfalls unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen und somit
Anspruch auf entsprechende Gesundheitsleistungen haben. Auch für diese
Anspruchsgruppe gilt es einen Zugang zu den ihnen zustehenden Leistungen zu
eröffnen. Hierfür müssen die Meldepflicht nach § 87 Aufenthaltsgesetz sowie der
Datenabgleich nach § 11 AsylbLG angepasst werden, damit Behörden bei der Prüfung
und Gewährung von Gesundheitsleistungen nicht länger verpflichtet sind – entgegen
bestehender Datenschutzgrundrechte – Informationen, die zum Zweck der
Existenzsicherung aufgenommen werden, zum Zweck der Migrationskontrolle an
Ausländerbehörden weiterzuleiten. Diese Regelung verhindert aktuell den Zugang zu
medizinischer Versorgung für Menschen ohne Papiere. Auch dieser Missstand wurde
bereits von der Bundesregierung anerkannt und eine Änderung im Koalitionsvertrag
vorgesehen: „Die Meldepflichten von Menschen ohne Papiere wollen wir überarbeiten,
damit Kranke nicht davon abgehalten werden, sich behandeln zu lassen.“
Unsere konkreten Empfehlungen
- Abschaffung des eingeschränkten Anspruchs auf Gesundheitsleistungen nach § 4
AsylbLG (klar definierter Anspruch auf alle notwendigen Gesundheitsleistungen
analog zum GKV-Leistungskatalog.) - Bundesweite Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte (oder eines
anderweitigen elektronischen Dokumentes, das die Abrechnung von
Gesundheitsleistungen in Arztpraxen, Kliniken, usw. ermöglicht). - Ausnahme von den Übermittlungspflichten (§ 87 AufenthG und § 11 AsylbLG) der
öffentlichen Stellen, wenn sie Leistungen zur Sicherung der Gesundheit sowie bei
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt erbringen oder gewähren.
Hintergrund und Erläuterung – Die Probleme im Einzelnen:
§ 4 AsylbLG beschränkt die Leistungen zum Erhalt der Gesundheit für
Leistungsbeziehende auf eine notdürftige Versorgung von akuter Erkrankung,
Schmerzzuständen, bei Schwangerschaft und Geburt sowie Schutzimpfungen.
Darüberhinausgehende Behandlungen z. B. von chronischen Erkrankungen,
Krankenhausbehandlungen, ambulante Operationen, Psychotherapie und
Physiotherapie müssen gesondert beantragt werden und können, wenn sie zum Erhalt
der Gesundheit unerlässlich sind, nach § 6 AsylbLG gewährt werden.
- Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit: Wie Asylsuchende diese
Ansprüche geltend machen können ist bundesweit und sogar innerhalb der
Bundesländer sehr unterschiedlich ausgestaltet. In einigen Bundesländern und
Kommunen erhalten Geflüchtete ab Registrierung eine elektronische
Gesundheitskarte. In anderen ist für einen Arztbesuch ein Behandlungsschein in
Papierform nötig. Wie Leistungsberechtigte diesen erhalten ist auch innerhalb
der Bundesländer (in unserer Erfahrung Bayern) sehr unterschiedlich geregelt:
manche Landkreise schicken einmal pro Quartal einen Schein zu, in anderen
kann der Krankenbehandlungsschein postalisch beantragt werden, in wieder
anderen muss er persönlich durch Vorsprache im Amt beantragt werden. Die
Krankenscheine werden für unterschiedlich lange Zeiträume,
Behandlungsumfänge, räumliche Geltungsbereiche ausgestellt. Diese
Uneinheitlichkeit erschwert auch die Beratung durch das Unterstützungssystem
und behandelnde Ärzt*innen. - Auch wegen fehlender Information, Aufklärung, Unterstützung und
Sprachmittlung werden notwendige Krankenbehandlungsscheine teilweise gar
nicht oder viel zu spät beantragt. Unter Umständen dauert es lange bis ein
Termin zur Beantragung eines Behandlungsscheins frei ist oder dieser aufgrund
der langwierigen behördlichen Vorgänge ausgestellt wird. Dadurch kommt es
häufig zu starken Verzögerungen von Diagnostik und Behandlung und
unnötigen Verschlimmerungen, Chronifizierungen und Weiterübertragung von
Krankheiten. - Unklarheit bezgl. des Anspruchs und der abrechenbaren Leistungen:
Aufgrund der vagen Regelung durch §§ 4 und 6 AsylbLG gibt es keinen eindeutig
definierten Rechtsanspruch. Welche Gesundheitsdienste und -leistungen für
Asylsuchende zugänglich gemacht werden, ist nicht wie bei GKV-Versicherten
durch einen umfassenden Katalog festgelegt, sondern hängt von der
Einschätzung und Auslegung des Gesetzestextes durch die leistungserbringende
bzw. -gewährende Person bzw. behördliche Instanz ab. Dies führt zu großer
Unsicherheit sowohl bei Geflüchteten, als auch bei Ärztinnen und Behördenmitarbeitenden und eröffnet einen fragwürdigen Spielraum für willkürliche Entscheidungen bei Leistungen, die die Gesundheit betreffend weitreichende, lebensgefährliche Auswirkungen haben können. Meist ist die Prüfung und Bewilligung von Gesundheitsleistungen nach § 6 AsylbLG bei Sozialämtern angesiedelt. Behördenmitarbeitende müssen dann fachfremd, meist nicht medizinisch ausgebildet, über die Notwendigkeit von medizinischen Behandlungen entscheiden. Dies stellt, vor allem, wenn zur besseren Einschätzung beispielsweise Gesundheitsämter einbezogen werden müssen, einen hohen Aufwand dar und führt zu teilweise langwierigen Prüfungs- und Bewilligungsverfahren. Wir erleben im Austausch mit unseren Klientinnen häufig restriktive Auslegung und Verweigerung von Leistungen, auch durch Ärztinnen. Dies geschieht teilweise auch aufgrund von Unwissenheit oder Unsicherheit. Umgekehrt kommt es vor, dass Ärztinnen eine Behandlung nicht vergütet bekommen, weil die zuständige Behörde im Nachgang entscheidet, dass sie nicht vom Behandlungsschein abgedeckt waren. - Durch das Papierkrankenscheinsystem wird auch die freie Arztwahl eingeschränkt. Behandlungsscheine werden teilweise auf Landkreise beschränkt, was problematisch sein kann, wenn bestimmte Fachärztinnen insbesondere auf dem Land kaum verfügbar sind. Behandlungsscheine verbleiben in der behandelnden Arztpraxis. Somit ist die Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung oft ausgeschlossen oder erst im neuen Quartal möglich, wenn ein neuer Behandlungsschein ausgestellt wird. Menschen, die in sog. Ankerzentren leben, sind gezwungen, sich ausschließlich an Ärztinnen der Unterkunft zu wenden und sind von deren Einschätzung abhängig, welche weitergehende medizinische Behandlung erfolgen soll und ob dafür ein Behandlungsschein beantragt wird.
Das Papierkrankenscheinsystem und der unklar definierte Leistungsanspruch
nach §§ 4 und 6 AsylbLG schaffen Komplexität und bürokratischen Aufwand für
alle Beteiligten. Diese administrativen Hürden ziehen gesundheitliche und
finanzielle Kosten nach sich.
Kontakt
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind für Sie da.